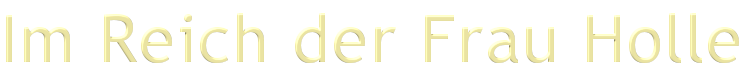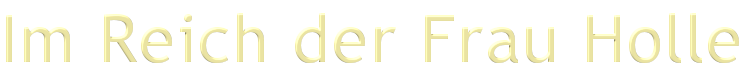or
Zeiten lebte ein Hirt in dem gewaltigen Bergland, das heute Tirol
heißt. Der war der geschickteste Jäger weit in den
Tälern. So hielt er Bären und Wölfe von
seiner Herde
fern und schoß auch manch edles Wild. Einmal stand er auf
hoher
Alm unter den friedlich äsenden Lämmern, und seine
Blicke
glitten weit über die Felsen. Da erblickte er einen Gemsbock
mit
goldenem Horn schußnah auf den Steinen. Schnell war der Bogen
gespannt und angelegt. Aber der Pfeil ritzte dem flüchtigen
Tier
nur die Lende und schwirrte ins Tal. Der Hirt sprang ihm nach. Der Bock
stutzte und wartete, floh wieder aus dem Schuß, und so ging
das
Spiel der Verfolgung von Zacke zu Zacke bis dicht an den Gletscher. Da
öffnete sich ein gläsernes Tor, und der Bock tauchte
ein in
die kühle Nacht. Wie nun der hitzige Hirt an das Tor kam,
gewahrte
er in der Tiefe fern einen Schein und folgte dem lockenden Licht. So
gelangte er denn in eine mächtige Halle. Wände und
Wölbungen blinkten vom edlen Kristall, und aus den Pfeilern
sprühte ein lockendes Licht wie von tausend Granatsteinen.
Hinter
glasklaren Wänden erkannte der Jäger blumige Matten
und
grünende Gründe. Inmitten dieser Rotunde aber stand
ein
erhabenes Frauenbild. Der goldene Gürtel umschloß
ihr
wallendes Silberkleid, und auf dem blonden Haarschopf blinkte die Krone
karfunkelhell. Ihre Hand umschloß einen Strauß von
zierlichen Blüten, so blau und so schön wie ihre
Augen. Es
weilten da auch die saligen Fräulein, die scharten sich mit
Alpenrosen im braunen Gelock um die strahlende Elbin. Der Hirt aber sah
nur auf jene königliche Gestalt. Da sprach die Erscheinung:
"Dies
ist das Jahr der Erfüllung. Da warten Silber und Gold, edle
Gesteine und schöne Mädchen. Eins davon steht dir zu.
Nun
wäge und wähle wohl, doch vergiß das Beste
nicht!" or
Zeiten lebte ein Hirt in dem gewaltigen Bergland, das heute Tirol
heißt. Der war der geschickteste Jäger weit in den
Tälern. So hielt er Bären und Wölfe von
seiner Herde
fern und schoß auch manch edles Wild. Einmal stand er auf
hoher
Alm unter den friedlich äsenden Lämmern, und seine
Blicke
glitten weit über die Felsen. Da erblickte er einen Gemsbock
mit
goldenem Horn schußnah auf den Steinen. Schnell war der Bogen
gespannt und angelegt. Aber der Pfeil ritzte dem flüchtigen
Tier
nur die Lende und schwirrte ins Tal. Der Hirt sprang ihm nach. Der Bock
stutzte und wartete, floh wieder aus dem Schuß, und so ging
das
Spiel der Verfolgung von Zacke zu Zacke bis dicht an den Gletscher. Da
öffnete sich ein gläsernes Tor, und der Bock tauchte
ein in
die kühle Nacht. Wie nun der hitzige Hirt an das Tor kam,
gewahrte
er in der Tiefe fern einen Schein und folgte dem lockenden Licht. So
gelangte er denn in eine mächtige Halle. Wände und
Wölbungen blinkten vom edlen Kristall, und aus den Pfeilern
sprühte ein lockendes Licht wie von tausend Granatsteinen.
Hinter
glasklaren Wänden erkannte der Jäger blumige Matten
und
grünende Gründe. Inmitten dieser Rotunde aber stand
ein
erhabenes Frauenbild. Der goldene Gürtel umschloß
ihr
wallendes Silberkleid, und auf dem blonden Haarschopf blinkte die Krone
karfunkelhell. Ihre Hand umschloß einen Strauß von
zierlichen Blüten, so blau und so schön wie ihre
Augen. Es
weilten da auch die saligen Fräulein, die scharten sich mit
Alpenrosen im braunen Gelock um die strahlende Elbin. Der Hirt aber sah
nur auf jene königliche Gestalt. Da sprach die Erscheinung:
"Dies
ist das Jahr der Erfüllung. Da warten Silber und Gold, edle
Gesteine und schöne Mädchen. Eins davon steht dir zu.
Nun
wäge und wähle wohl, doch vergiß das Beste
nicht!"
Der Hirt blickte rund und fehlte wenig, so wäre da die Macht
seiner Sinne vergangen. Das Beste zu finden im Glanz dieser Dinge,
erschien ihm unmöglich. Da gewann sein Auge die Ruhe
zurück
im Blick auf die Blüten. Er bat: "Gib die!"
"Du hast das Beste erwählt", sagte die Weiße Frau,
"nimm hin
die Blumen und nimm auch die Samen, damit du sie fürder
anbauen
kannst."
Ein Donnerton riß dem Hirten den Dank vom Mund, und er sank
in
Schlaf. Zwischen Eisgebilden und Felsen am Gießbach fand er
sich
wieder. Aber das gläserne Tor war verschüttet, und
nur die
Wunderblume auf seinen Knien und ein silberner Scheffel mit
Samenkörnern bezeugten die Wahrhaftigkeit jener Erscheinung.
Sein erster Gedanke galt nun seiner Herde. Aber die mußte
sich
weithin verstiegen haben, denn er vermochte nicht einen
Lämmerschwanz zu erblicken. Als er am Abend die eigene
Hütte
betrat, da fand er sein Weib und die Kinder in Kummer und Elend. Denn
nun erst wurde ihm offenbar, daß er ein volles Jahr im Berge
verborgen gewesen, und hatte es nicht gewußt. Dieweilen
hatten
die wilden Tiere sein Vieh zerrissen. Schwer war es da, die
Tränen
der Seinen hinweg zu trösten. Er aber vertraute auf das
Geschenk
und machte sich gleich an die Arbeit. Mit Feuer und Steinbeil rodete er
ein Gehölz, mit Hacke und Spaten bestellte er dann den Acker,
den
Samen der Blume ins lockere Erdreich zu senken. Wohl schalt ihn die
Frau einen Narren, und er sollte sich lieber um Nahrung und Notdurft
bemühen. Er aber hat nicht nachgelassen und immer neue Furchen
gegraben und hat noch ein zweites und drittes Feld eingesät.
Mit
dem Mairegen schossen die grünen Stengelein auf, und bald
wogten
die Äcker in blauen Blüten. Wenn dann der Hirt bei
Vollmondschein von der Pirsch kam, so sah er wohl, wie die Herrin der
Berge segnend die Hände über die blauen Gefilde
gebreitet
hatte. Da ging die Blüte bald in Frucht. Als nun der Sommer
verrinnen wollte, lehrte die Weiße Frau den Bauern die Kunst
der
Flachsbereitung. Sie gab ihm den Spruch:
"Gerauft,
getauft,
geröstet, geriffelt, gedörrt,
gebrochen, geschwungen,
gehechelt, gesponnen,
gewoben, geblichen,
geschneidert, getragen,
verschlissen."
So hat denn der Mann im Winter mit tanzender Spindel den ersten Faden
gedreht. So wob er aus Kette und Schuß das erste Geflecht
einer
grauen Leinwand. Und als die Frühlingssonne über die
grüne Bleiche strich, bleichte das Tuch am Wiesenbach so
weiß wie Schnee. Daraus wurde das erste Hemd zugeschnitten
und
später das erste Kleid genäht. So wuchs aus der
unscheinbaren
Blume ein großer Segen für alle Menschen. Denn bald
erkannten alle die Wohltat und Schönheit des leichten
Gewandes,
legten über Sommertag die plumpen Pelze und groben Wolljacken
ab,
dankten dem Hirten und priesen seine Erfindung.
Der glückliche Weber hat Kinder und Kindeskinder erlebt. Und
noch
immer blühte Frau Berchtas blaues
Sträußchen im grauen
Steinkrug. Aber in der Frühlingsfrühe eines Morgens
fand der
greise Meister die Blüten mit abgewelkten und fahlen
Köpfchen. Da wußte der Hochbetagte wohl,
daß auch sein
Lebenslicht niedergebrannt war. Stillen Mutes hat er sein Feiergewand
angelegt und ist in die Einöde gestiegen, talauf, wo er vor
Zeiten
in glücklicher Fügung den Sinn seines Schicksals
gefunden
hatte. Im Gletscher war das verschüttete Tor wieder aufgetan,
und
es war ein feierlicher Abend rings umher, daß die
Flächen
von Eis und die Zinnen der Berge feuergold glühten.
Im Osten
stieg
eben der Mond hoch, und aus der Höhle rief ihn das alte Licht.
Da
ist er gelassen eingetreten. Hinter ihm hat
der Berg sich donnernd
geschlossen, und kein
Sterblicher hat seither den Alten jemals von
Angesicht wiedergesehen.
|
Karl Paetow,
Die blaue Blume. In: Frau
Holle: Märchen und Sagen,
S. 50 -53
|